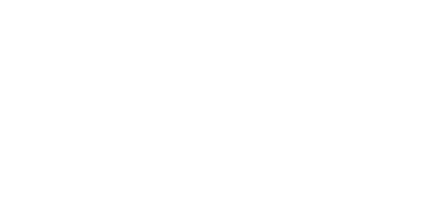Hintergrund ist das vom BMEL geförderte IsWEL-Projekt (In-situ Erhaltung von Wildpflanzen für Ernährung und Landwirtschaft mittels Schirmarten), ein Modell- und Demonstrationsvorhaben unter Beteiligung der HGU, der Hochschule Anhalt, des Botanischen Gartens Osnabrück und des Julius Kühn-Instituts (JKI). Zentrales Anliegen ist die gezielte Erhaltung von WEL-Arten (Wildpflanzen für Ernährung und Landwirtschaft) als wichtige genetische Ressource für die Anpassung unserer Ernährungssysteme an den Klimawandel.
Dr. Imke Thormann, Informations- und Koordinationszentrum für Biologische Vielfalt (IBV) der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE), eröffnete die Tagung mit einer Vorstellung des Netzwerks Genetischer Erhaltungsgebiete Deutschland. Maria Bönisch, Doktorandin an der HGU, berichtete über die im Rahmen des IsWEL-Projekts durchgeführte Hotspot-Analyse, die 76 potenzielle Flächenkandidaten in ganz Deutschland identifizierte. Diese könnten bei erfolgreicher Überführung in den freiwilligen Schutzstatus eines Genetischen Erhaltungsgebiets 85 % aller in Deutschland besonders relevanten WEL-Arten sichern.
Die Etablierung eines Genetischen Erhaltungsgebiets ist jedoch nicht trivial. In der Debatte wurden verschiedene Hindernisse thematisiert, darunter mangelnde Anreize für Flächeneigner, Schwierigkeiten bei der Identifikation und Ansprache multipler Eigentümer sowie Unsicherheiten bezüglich früherer Aussaaten, die die lokale Genetik verfälschen könnten.
Weitere Vorträge beleuchteten Teilnetzwerke genetischer Erhaltungsgebiete, die sich auf spezifische WEL-Arten wie Wildrebe, Arnika und Wildsellerie konzentrieren. Silvia Oevermann vom Botanischen Garten Osnabrück erläuterte die Arbeit der WEL-Genbank zur langfristigen Sicherung von Saatgutproben aus Genetischen Erhaltungsgebieten. Dr. Stefan Michalski vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung präsentierte Erkenntnisse aus dem RegioDiv-Projekt zur Genetik krautiger Pflanzen und zur Weiterentwicklung des Konzepts der 22 Ursprungsregionen in Deutschland.
Olivier Magnin von der Berner Fachhochschule stellte den Schweizer Ansatz vor, bei dem Landwirte durch finanzielle Anreize motiviert werden, WEL-Vorkommen im Rahmen der Agrarförderung selbst zu melden (Bottom-up-Ansatz). Ein ähnliches Vorgehen könnte auch in Deutschland den Aufwand zur Flächenakquise reduzieren und die Beteiligung lokaler Akteure fördern.
Das IsWEL-Projekt hat Wege zur Sicherung der WEL-Arten in Deutschland aufgezeigt. In einem Workshop unter dem Titel „Grundlagen einer neuen Strategie in Deutschland" wurden notwendige Rahmenbedingungen für eine effektive Umsetzung erörtert.