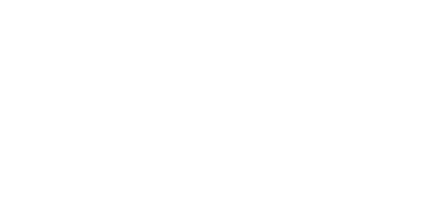Forschungsprojekte der Professur
Projektanfang: 01.07.2023
Projektende: 30.06.2026
Förderer: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit
Der Erhalt und die Vermehrung städtischen Grüns, insbesondere von Bäumen, spielen eine zentrale Rolle bei der Anpassung von Städten an den Klimawandel, da sie eine natürliche Kühlung ermöglichen. Größere Bäume transpirieren bis 500 Liter Wasser pro Tag. Schatten und Verdunstungskälte mindern den Effekt urbaner Hitzeinseln. Streusalz, Bodenverdichtung und Schadstoffe belasten Stadtbäume jedoch. Hitze und Trockenheit intensivieren sich, sodass Neupflanzungen oft nicht anwachsen und Bestandsbäume vermehrt absterben, bevor sie eine klimawirksame Größe erreichen. Alternative Baumsubstrate könnten hier Abhilfe schaffen und auch die Infiltration von Wasser aus Starkregenereignissen verbessern. Ein vielversprechender Ansatz sind Pflanzenkohle-Macadam-Substrate (PMS), d.h. definierte Gemische aus Gesteinsschotter, Pflanzenkohle und Kompost. Der Schotter ergibt nach Verdichtung eine befahrbare, aber porenreiche Struktur, die Raum und Luft für Wurzelwachstum schafft und hohe Niederschläge aufnehmen können. Durch die Herstellung der Pflanzenkohle wird zudem Biomasse-Kohlenstoff langfristig gebunden (Kohlenstoffsenken). PMS wurden in Stockholm entwickelt und werden bisher nur in Schweden, Österreich und der Schweiz angewendet. Das Ziel von "Black2GoGreen" ist der Aufbau eines Netzwerks aus Kommunen, kommunalen Betrieben, Verbänden sowie Herstellern von Pflanzenkohle und Substraten, um Wissen über bereits implementierte Lösungen nach Deutschland zu transferieren.
Projektanfang: 01.04.2016
Projektende: 31.12.2019
Förderer: Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand
Das Ziel bei der Entwicklung der begrünten Fassadenkacheln war ein optisch ansprechendes System, mit dem durch einen einfachen Modulsegmentaufbau große Gebäudeflächen kostengünstig und wartungsarm begrünt werden können. Der Modulaufbau ermöglicht sowohl für Neubauten als auch nachträglich für Altbauten eine speziell zugeschnittene Fassadenbegrünung mit verschiedensten Vegetationsbildern. Die grüne Fassade soll einen Dämmschutz sowie einen Fassadenschutz gegen Witterung bieten, die Hitze- und Staubbelastung reduzieren und damit die Umweltsituation spürbar verbessern. Dabei sollte die Grüne Wand aus textilem Pflanzenträger möglichst wartungsarm entwickelt werden. An der Hochschule Geisenheim wurde primär an der Pflanzenauswahl, deren vertikalen Entwicklung und Pflege für alle vier Himmeslrichtungen (N, S, O, W) geforscht. Für einen schnellen vertikalen Begrünungserfolg wurde zusätzlich die Voranzucht der Vegtation auf den textilen Trägerelementen im Gewächshaus untersucht.